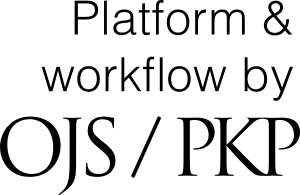Psalm 61: »Nanga Parbat«. Rabbinisch-benediktinische Psalmen-Betrachtung
DOI:
https://doi.org/10.25786/cjbk.v0i01-02.452Abstract
Thema
Wir greifen auf die jüdische Übersetzung von
Rabbiner Ludwig Philippson (1811–1889) in der
von Rüdiger Liwak revidierten und von R. Walter
Homolka edierten zweisprachigen Bibel-Ausgabe
zurück, deren 3. Teil, Ketuwim, Die Schriften,
mit Unterstützung von Karl-Hermann Blickle soeben
im Herder-Verlag erschienen ist. Die Wortwahl
von R. Philippson haben wir nur leicht abgeändert,
wo sie das psalmische Echo stört.
Es stehen auch andere Neuausgaben älterer
deutsch-jüdischer Psalmen-Übersetzungen zur
Verfügung: die klassischen von Moses Mendelssohn
(Jubiläumsausgabe 10, 1) und von R. Michael
Sachs in der Zunz-Bibel (S. 1174), die zeitgenössische
von Samson Raphael Hirsch (1882,
1988), die moderne von Martin Buber (Buch der
Preisungen, 1935) und die von Emil Bernhard-
Cohn in der sogenannten Berliner Bibel von N.
H. Tur-Sinai (1937, 2013).
Aber Philippsons Psalmen-Übersetzung, die
auch wieder separat zu haben ist, empfiehlt sich
immer noch durch die geschmeidige Vermittlung
von Ur- und Zielsprache, sie übersetzt, wie gesagt
worden ist, treu und schön zugleich. Das sieht
man schon an der Psalm-Überschrift – Mendelsohn
bleibt exotisch: Dem Sangmeister auf Neginoth,
Hirsch schwelgt in Etymogeleien: Dem Siegverleiher
über die Töne des Gesanges, Buber ist
wie so oft ungewollt komisch: Des Chormeisters,
auf Saitengerät, Cohn überrascht mit dem Begleiter
auf dem Saitenspiel, nur Philippson bringt die
Konzision eines Theaterzettels zustande: Dem
Sangmeister. Mit Saitenspiel. Außerdem soll das
große liberale Bibelwerk des Deutschen Judentums angezeigt werden, das von 1839–1854
unter dem Titel: Israelitische Bibel. Enthaltend
den heiligen Urtext, die deutsche Uebertragung,
die allgemeine ausführliche Erläuterung mit mehr
als 500 englischen Holzschnitten erschienen ist.
Aber nun zum Psalm.
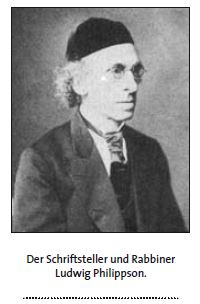
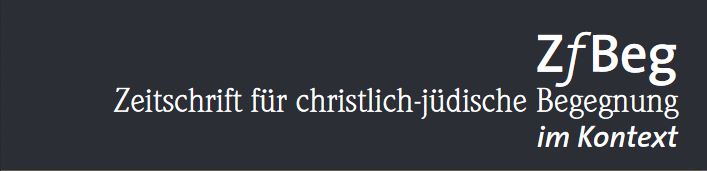
 Alle Inhalte dieser Webseite und der Zeitschrift sind (sofern nicht anders angegeben) lizenziert mit einer
Alle Inhalte dieser Webseite und der Zeitschrift sind (sofern nicht anders angegeben) lizenziert mit einer