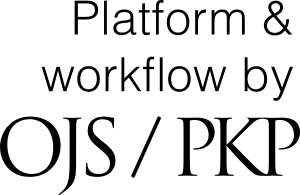Rezension zu: Schottlaender, Rudolf (2017): Deutschsein fünfmal anders Erinnerungen eines Unangepassten, (hrsg. von Selle, Irene; Reininghaus, Moritz) Verlag für Berlin-Brandenburg, Berlin, 200 Seiten.
DOI:
https://doi.org/10.25786/cjbk.v0i01-02.587Abstract
Der Philosoph und Altphilologe jüdischer Herkunft
Rudolf Schottlaender (1900 –1988) hat seinen Lebenserinnerungen
einen Titel gegeben, der die Zugehörigkeit
zum Deutschen betont – und die Spannung, das Problematische
daran; er, der die Nazizeit in Deutschland
überlebte und danach mehrmals zwischen dessen beiden
Teilen wechselte, beantwortet die Frage nach seinem
»merkwürdigen Lebensweg« mit dem schlichten Satz: »So wie ich es sehe, bin ich mir in einer ganz einfachen
Weise treu geblieben.« (S. 188) Weil es so war,
kam es zu den mehrmaligen heftigen Wendungen in
seinem Lebensverlauf; dass es so war, verleiht den Erinnerungen
wohltuende Eigendistanz, unaufwändige
Größe, auch lakonische Kürze.
Was beschreibt Rudolf Schottlaender und wie beschreibt
er es? Nicht um Vollständigkeit geht es ihm, er
erzählt eher anekdotisch; die Darstellung emotionaler
Zustände und Konflikte, psychologische Tiefenschürfung
sind seine Sache nicht. Er ist ein rational gesteuerter
Mensch und ist stolz darauf. Doch gilt ihm Vernunft
immer als Mittel zum Verständnis menschlicher Lebensprobleme;
sie zum Instrument mechanistischer Welterfassung
zu machen hieße für Schottlaender, sie zu missbrauchen.
Zu den Stationen seines Lebens: Der Vater betrieb
in Bromberg, dem heutigen Bydgoszcz, ein Textilunternehmen.
Der Sohn widersetzte sich dem Lebensmodell
des Vaters, studierte Philosophie und Altphilologie in
Berlin bei Ernst Cassirer, Ernst Troeltsch und Eduard
Fraenkel und in anderen Universitätsstädten bei Jaspers,
Husserl und Heidegger. Schon da galt Schottlaenders
Hauptinteresse der Ethik, und Praxisnähe wurde sein
philosophisches Credo; künstlerische Interessen begleiteten
sein Denken stets. 1923 promovierte er mit einer
Arbeit zur aristotelischen Ethik. Unter dem prägenden
Einfluss stoizistischen Denkens und besonders Spinozas
trat er in diesen Jahren aus der jüdischen Gemeinde
aus.
Die Nazis kamen an die Macht, und die zweite
Phase des Deutschseins von Rudolf Schottlaender begann.
Die Rassengesetze trafen ihn durch Ausschluss aus
dem öffentlichen Leben, vorerst aber nicht als akute
existentielle Gefährdung: Seine privilegierte Mischehe
mit einer Frau arischer Herkunft und der Umstand,
dass die gemeinsamen Söhne nicht jüdisch erzogen
wurden, bewahrten ihn vor der Deportation und dem
Tragen des gelben Sterns. Nichtsdestoweniger war es
eine Zeit der Demütigung und Einsamkeit, in der er,
wie er schreibt, der Charaktertyp wurde, als der er die
zweite Hälfte seines Lebens bestanden hat: voll »Entschlossenheit,
philosophische Denkweisen antiken Ursprungs
nun auch selbst zu bewähren, danach zu
leben“ (88), das heißt, „mir neben der entschiedensten
Verwerfung der Barbarei so viel Objektivität wie möglich
zu bewahren und meine Urteile nicht durch Hass
trüben zu lassen. [...] auch die Furcht und der Zorn
[sollten mir] möglichst fern bleiben.« (S. 86) Für diese
an den Stoikern geschulte Gelassenheit gibt es in den Erinnerungen
frappierende Beispiele: materielle Uninteressiertheit,
Distanz zu Ehrgeiz und Karriere, Furchtlosigkeit
in Situationen großer Gefährdung.
Mit dem Ende des Nationalsozialismus begann die
dritte, vorerst beglückende Etappe in Schottlaenders
Deutschsein. Der Einmarsch der Roten Armee bedeutete
für ihn tatsächliche Befreiung. Von seiner Frau, die
sich in den Hitler-Jahren zunehmend von dem jüdischen
Ehemann entfernt hatte, wurde er geschieden. An der
Volkshochschule gab er Philosophiekurse und begegnete
dort seiner neuen Lebensgefährtin. Er wurde als Philosophie-
Professor an die Technische Hochschule Dresden
berufen, doch dort ist seines Bleibens nicht lange:
Seine Erklärung, am 1. Mai (1949) nicht unter Hass-
Parolen demonstrieren zu können, führte zur abrupten
Kündigung.
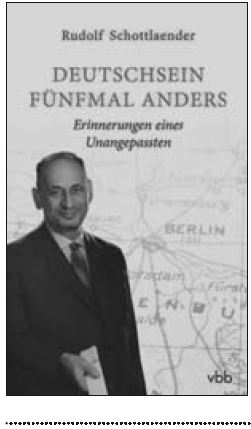
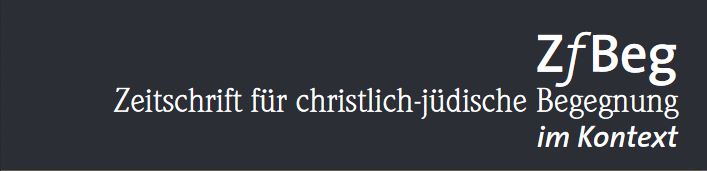
 Alle Inhalte dieser Webseite und der Zeitschrift sind (sofern nicht anders angegeben) lizenziert mit einer
Alle Inhalte dieser Webseite und der Zeitschrift sind (sofern nicht anders angegeben) lizenziert mit einer