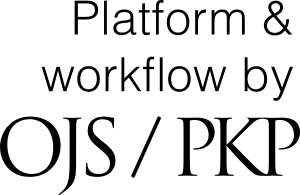Rezension zu: Brumlik, Micha (Hg.) (2017): Luther, Rosenzweig und die Schrift. Ein deutsch-jüdischer Dialog. Mit einem Geleitwort von Margot Käßmann, CEP Europäische Verlagsanstalt, 295 Seiten.
DOI:
https://doi.org/10.25786/cjbk.v0i01-02.590Abstract
Im Lutherjahr erschien unter dem Titel »Luther,
Rosenzweig und die Schrift“ ein von Micha Brumlik
herausgegebenes Buch zu Luthers Übersetzungskunst:
eine vielstimmige, kritische, auch klärende Essaysammlung
über das Verhältnis zwischen dem hebräischen
Original der Bibel und Luthers Übertragung, in der sich
die Übersetzungsfrage rasch zu einer Auseinandersetzung
zwischen Rosenzweigs eigener Auslegung der
Schrift, dem Gewicht des deutschen Nationalismus damals
und später, überhaupt zwischen Geschichte und
Religion, Schuld und Sprache erweitert.
Der jüdische Religionsphilosoph Franz Rosenzweig
(1886 –1929) veröffentlichte 1926 einen Aufsatz »Luther
und die Schrift«, der hier im Jahre 2017 zum Mittel-
und Ausgangspunkt für einen »deutsch-jüdischen
Dialog« dient. Richtig: nicht christlich- jüdisch, sondern
deutsch-jüdisch – so steht es im Titel. Unter »Schrift«
versteht er den Tanach, die jüdische Bibel, was nicht
genau dasselbe ist wie das christliche Alte Testament.
An dem Gespräch beteiligen sich jüdische und nichtjüdische
Gelehrte verschiedener Sparten; unter ihnen
nimmt Micha Brumlik als emeritierter Professor für Erziehungswissenschaften,
ehemaliger Direktor des Fritz-
Bauer-Instituts und jetziger Senior-Professor am Zentrum
jüdische Studien Berlin/Brandenburg, einen besonderen
Platz ein. In seinem Vorwort skizziert er Rosenzweigs
Epoche mit dem Blick des Nach-der-Shoah-
Geborenen: er sieht Rosenzweigs Essay als »eines der
deutlichsten, wenn nicht das deutlichste Zeugnis jener
Kultur, die das deutsche Judentum wähnte, dem Protestantismus
zu schulden.«
Es folgt Rosenzweigs Original-Essay; daran anschließend
kommentieren Heutige das, was Rosenzweig
im Essay sagt; ihre Untersuchungen umfassen den von
Brumlik herausgestellten Gegensatz ebenso wie die
weiteren Verzweigungen von Rosenzweigs Gedanken.
Rosenzweig hatte (u.a.) gründlich Hegel studiert und
war 1914 freiwillig in den Krieg gezogen. Schon 1913
hatte er sich in intensiven Gesprächen mit Freunden,
die fast alle zum Christentum – meist Protestantismus –
übergetreten waren, entschlossen, selbst Jude zu bleiben.
Im Krieg begegnete er dem »Ostjudentum«, bei dem
er eine Unmittelbarkeit entdeckte, welche die westlichen
Juden verloren hatten. Zusammen mit dem Rabbiner
Nehemia Nobel gründete er 1919 das Frankfurter
»Freie Jüdische Lehrhaus«. Auch setzte er sich gedanklich
und praktisch mit dem Übersetzen auseinander.
Daher beginnt sein Essay aus dem Jahr 1926 mit den
Sätzen: »Übersetzen heißt zwei Herren dienen. Also
kann es niemand.« Eigentlich sei alles Reden schon
Übersetzung, meint er, nämlich Übertragung des Ur-
Eige- nen in etwas, das ein anderer verstehen kann. So
würden wir – übersetzend – zu einem »Mut der Bescheidenheit
« gelangen, der nicht das »erkannte
Unmög- liche, sondern das aufgegebene Notwendige
von sich selbst fordert«. Und das, erkennt er, gehe über
Luthers Text weit hinaus. Luther habe bei seiner Arbeit
»die Wünschelrute seines Glaubens« besessen, d.h.
seine Wortwahl folgte seinem persönlichen Glauben,
der noch eine mittelalterliche Färbung hatte.

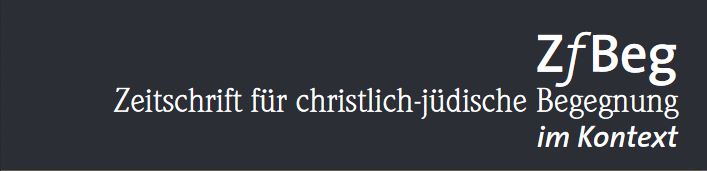
 Alle Inhalte dieser Webseite und der Zeitschrift sind (sofern nicht anders angegeben) lizenziert mit einer
Alle Inhalte dieser Webseite und der Zeitschrift sind (sofern nicht anders angegeben) lizenziert mit einer